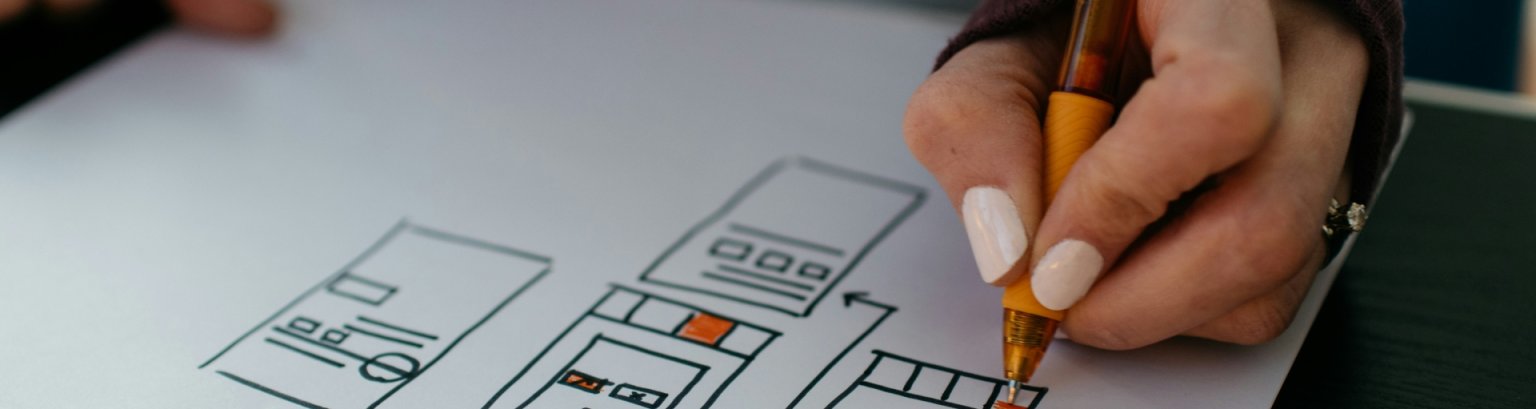Kommunale Wärmeplanung
Die Stadt Tettnang stellt sich aktiv den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende. Ein zentraler Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität ist die kommunale Wärmeplanung. Sie zeigt auf, wie Tettnang in den kommenden Jahren eine nachhaltige und klimafreundliche Wärmeversorgung aufbauen kann – für bestehende Gebäude, Neubaugebiete, öffentliche Liegenschaften, Unternehmen und private Haushalte.
Die kommunale Wärmeplanung ist dabei nicht nur ein technisches Instrument, sondern ein strategischer Leitfaden für die zukünftige Energieversorgung unserer Stadt. Sie dient als Grundlage, um gezielt Maßnahmen umzusetzen, die den CO₂-Ausstoß senken und die lokale Energiewende voranbringen.
Am 23. Oktober 2024 hat der Gemeinderat Tettnang die Erstellung des kommunalen Wärmeplans beschlossen. Mit der fachlichen Ausarbeitung wurde das Planungsbüro EGS-plan Ingenieurgesellschaft für Energie-, Gebäude- und Solartechnik mbH beauftragt. Das Projekt wird durch eine Bundesförderung in Höhe von 90 Prozent unterstützt und erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg (KlimaG BW). Die finale Beschlussfassung des kommunalen Wärmeplans ist für den 17. Dezember 2025 im Gemeinderat vorgesehen.
Am 10. November 2025 fand im Foyer der Stadthalle Tettnang die Öffentlichkeitsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung statt. Dabei wurde vorgestellt, was die Wärmeplanung ist, welche erneuerbaren Energiepotenziale in Tettnang vorhanden sind, wo Potenziale für den Aufbau eines Wärmenetzes bestehen (auf der Karte grün dargestellt) und in welchen Bereichen eine dezentrale Wärmeversorgung sinnvoller ist (auf der Karte orange dargestellt). Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich einzubringen. Bis zum 10. Dezember 2025 besteht die Möglichkeit, Rückmeldungen und Anregungen bei Klimamanagerin Katharina Kuhn einzureichen.

Was ist Kommunale Wärmeplanung?
Die Kommunale Wärmeplanung (KWP) ist ein langfristiger Planungsprozess mit dem Ziel, die derzeit noch überwiegend fossile Wärmeversorgung – etwa durch Gas- oder Ölheizungen – durch klimaneutrale Wärmequellen wie Solarthermie, Umweltwärme, Geothermie, Biomasse oder Abwärmenutzung zu ersetzen.
Dabei wird die Stadt und das Planungsbüro in vier Phasen tätig:
1. Analysephase:
Erhebung des Ist-Zustands: Energieverbräuche, Heizsysteme, Gebäudestruktur, bestehende Infrastruktur. Die Daten werden aufbereitet, kartiert und systematisch ausgewertet.2. Potenzialanalyse:
Welche erneuerbaren Energien stehen lokal zur Verfügung? Welche Versorgungslösungen passen zu welchen Quartieren? Auch technische Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen werden einbezogen.3. Zielentwicklung:
Aus der Analyse werden realistische Entwicklungspfade abgeleitet – differenziert nach Stadtteilen, Gebäudetypen und Zeitrahmen. Dabei wird ein Szenario entwickelt, wie Tettnang bis 2040 (oder früher) eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung erreichen kann.4. Maßnahmenplan:
Der Plan benennt konkrete Schritte zur Umsetzung – z. B. Erweiterung von Wärmenetzen, Unterstützung privater Sanierung, Ausweisung geeigneter Neubaugebiete oder Förderung innovativer Projekte. Empfehlungen für Politik, Verwaltung sowie Bauherrinnen und Bauherren schließen den Prozess ab.Die Ergebnisse der Wärmeplanung werden in einem kommunalen Wärmeplan zusammengefasst, der gemäß § 25 Absatz 1 WPG regelmäßig – etwa alle fünf Jahre – fortgeschrieben werden kann und der der Stadt als wichtige Entscheidungsgrundlage dient.
Was wird im Rahmen der Wärmeplanung untersucht?
Die Kommunale Wärmeplanung betrachtet sämtliche Aspekte des Wärmebedarfs und -angebots im Stadtgebiet:
- Gebäudestruktur: Analyse des Energiebedarfs für Heizen und Warmwasser in allen Quartieren – Wohngebäude, Gewerbe, Industrie, öffentliche Einrichtungen
- Wärmeinfrastruktur: Untersuchung bestehender Wärmenetze, Versorgungssysteme und Potenziale für Netzerweiterung
- Erneuerbare Wärmequellen: Identifikation nutzbarer lokaler Potenziale (Solarthermie, Biomasse, Abwärme, Geothermie, Wärmepumpen)
- Sanierungspotenziale: Betrachtung energetischer Einsparmöglichkeiten im Gebäudebestand
- Gebietstypisierung: Welche Stadtteile eignen sich eher für Wärmenetze, wo sind individuelle Lösungen sinnvoll?
- Zukunftsszenarien: Modellierung von Entwicklungspfaden hin zur klimaneutralen Wärmeversorgung
Diese Daten bilden die Grundlage für den Maßnahmenkatalog, der kurz-, mittel- und langfristige Optionen benennt – sowohl für die öffentliche Hand als auch für private Eigentümerinnen und Eigentümer.
Eignungsprüfung nach § 14 WPG und ihre Bedeutung für die kommunale Wärmeplanung
Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erfolgt eine Eignungsprüfung gemäß § 14 WPG, um festzustellen, ob bestimmte Teilgebiete für die Versorgung durch Wärmenetze oder Wasserstoffnetze mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geeignet sind. Diese Prüfung findet in einer frühen Phase der Wärmeplanung statt. Resultiert aus der Prüfung keine Eignung besteht die Option für diese Teilgebiete eine verkürzte Wärmeplanung durchzuführen.
Die Ergebnisse der Eignungsprüfung in Tettnang sind in der angehängten Datei enthalten. Das Regelverfahren zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wird für das gesamte kommunale Gebiet angewendet. Die Anwendung des verkürzten Verfahrens wird als nicht erforderlich erachtet, da keine nennenswerte Reduzierung des Planungsaufwands erwartet wird.
Hat der kommunale Wärmeplan rechtliche Wirkung, und wer ist für die Umsetzung zuständig?
Der kommunale Wärmeplan ist ein strategisches Planungsinstrument ohne rechtliche Verbindlichkeit.
Für Eigentümerinnen und Eigentümer entstehen daraus keine Pflichten.
Die im Plan dargestellten Versorgungsarten – beispielsweise ein Wärmenetz oder eine dezentrale Wärmeversorgung – sind Empfehlungen und keine Vorgaben.
Es besteht also keine Verpflichtung, die vorgeschlagene Versorgungsart zu nutzen oder bestimmte Anlagen zu errichten. Die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer sind weiterhin für die individuelle Wärmeversorgung ihrer Gebäude verantwortlich.Auch Energieversorgungsunternehmen (z. B. das Regionalwerk) sind nicht verpflichtet, Wärmenetze oder Wärmeerzeugungsanlagen zu errichten oder zu betreiben.
Ob und in welchem Umfang entsprechende Projekte umgesetzt werden, hängt von der wirtschaftlichen Machbarkeit und der Nachfrage ab.Mein Gebäude steht in einem Gebiet mit dezentraler Versorgung. Was muss ich beachten?
In den dezentral versorgten Clustern wird die Wärme auch zukünftig direkt im Gebäude erzeugt.
Ein Anschluss an ein Fernwärmenetz ist dort nicht vorgesehen.Die klimafreundlichsten Heiztechnologien in diesen Bereichen sind in der Regel Wärmepumpen oder Systeme mit Geothermiesonden. Welche Lösung in Ihrem Fall am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab – etwa vom Alter und Zustand Ihres Gebäudes, der Größe, der Siedlungsstruktur und Ihrem Investitionsbudget.
Wir empfehlen daher eine individuelle Energieberatung. Eine kostenlose Erstberatung (1 Stunde) findet einmal im Monat im Rathaus Tettnang statt. Eine Anmeldung ist hier möglich.
Mein Gebäude steht in einem Eignungsgebiet für Fernwärme. Gibt es einen Anspruch auf Fernwärme? Was kann ich tun?
Mit der Einteilung eines Gebietes als Eignungsgebiet für Fernwärme besteht kein Anspruch auf einen Anschluss an das Fernwärmenetz.
In Tettnang hat der Ausbau des Nahwärmenetzes im Jahr 2025 begonnen. Das Regionalwerk Bodensee und ENGIE Deutschland übernehmen als Partner innerhalb der Wärmeversorgungsgesellschaft Tettnang mbH gemeinsam die Umsetzung.In einem ersten Schritt werden 14 städtische und landeseigene Gebäude an das Netz angeschlossen.
In den kommenden Jahren ist geplant, das Nahwärmenetz schrittweise auf angrenzende Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete zu erweitern.Bei Fragen zum Nahwärmenetz, zum Ausbau oder zu möglichen Anschlüssen wenden Sie sich bitte direkt an die Wärmeversorgungsgesellschaft Tettnang mbH. Hier finden Sie die aktuellen Informationen.